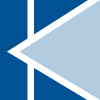06 Okt. Artikel Mitarbeiterzeitung des Prosper-Hospitals – Berücksichtigung von Gesundheitskosten bei der Steuererklärung
von Markus Regnitter
Gesundheits- und Krankheitskosten können eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Daher ist es wichtig zu wissen, in welchem Umfang diese Kosten steuerlich berücksichtigt werden können.
Optimal wäre es, diese Kosten direkt vom Arbeitgeber tragen zu lassen. Sofern die Übernahme von Gesundheitskosten kein Arbeitslohn sind, fallen nämlich auch keine Lohnsteuern oder Sozialversicherungsbeiträge an. Die Möglichkeit für den Arbeitgeber, Gesundheitskosten der Arbeitnehmer zu tragen, sind allerdings stark eingeschränkt. Für die betriebliche Gesundheitsförderung kann der Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn beispielsweise jährlich 600,- € pro Mitarbeiter ausgeben. Dazu zählen beispielsweise Kurse zur gesunden Ernährung, Rückengymnastik und Suchtprävention. Selbst der Yoga-Kurs kann dazu zählen. Nicht gefördert werden können jedoch Beiträge zu Sportvereinen oder zum Fitnessstudio. Des Weiteren kann der Arbeitgeber eine spezielle Sehhilfe für den Bildschirmarbeitsplatz steuerfrei erstatten, wenn der Arbeitgeber aufgrund der Vorschriften des Arbeitsschutzes dazu verpflichtet ist und ein entsprechendes Attest vorliegt.
Alle anderen Gesundheits- sowie Krankheitskosten stellen private Kosten dar, die steuerlich zunächst ohne Belang sind. Allerdings hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eingeräumt, Gesundheitskosten als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuererklärung anzusetzen und somit zumindest ein Teil der Kosten über eine Steuererstattung kompensieren zu können.
Voraussetzung ist, dass diese Aufwendungen zwangsläufig entstehen und den Steuerpflichtigen wesentlich beeinträchtigen. Medizinisch notwendige Gesundheitskosten gelten grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung. Das gilt z.B. für Kosten für Zahnersatz, Brillen, Medikamente, Hörhilfen, medizinische Hilfsmittel, sofern diese nicht von einer Versicherung erstattet werden. Damit das Finanzamt die Aufwendungen aber anerkennt, ist ein Nachweis der Zwangsläufigkeit erforderlich. Für die Medikamente und Behandlungen genügt in der Regel das ärztliche Rezept. Bei größeren Maßnahmen, wie z.B. Kuren, verlangt das Finanzamt meist ein amtsärztliches Attest oder eine Bescheinigung des medizinischen Dienstes. Liegt dieses nicht vor, wird das Finanzamt die Kosten wahrscheinlich nicht anerkennen.
Die steuerliche Entlastung tritt allerdings erst ein, wenn die sogenannte zumutbare Eigenbelastung überschritten wird. Diese ist abhängig vom Einkommen, Familienstand und Kinderanzahl. Die zumutbare Belastung beträgt je nach Voraussetzungen zwischen 1 % und 7 % des Gesamtbetrages der Einkünfte. Ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern und einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 60.000,- € hat z.B. eine zumutbare Eigenbelastung von 1.735,30 €. Nur Kosten, die diesen Betrag überschreiten, wirken sich dann steuermindernd aus.
Wichtig ist auch zu wissen, dass es auf den Zahlungszeitpunkt ankommt. Es empfiehlt sich daher Kosten möglichst zusammen in einem Jahr zu bezahlen, um die zumutbare Belastung zu überschreiten. Daher kann es sich beispielsweise anbieten, kostenträchtige Maßnahmen wie z.B. der Einbau eines notwendigen Treppenliftes, Zahnersatz oder Brillen in einem Jahr gebündelt zu bezahlen.
Besonderheiten gelten bei Pflegekosten oder Schwerbehinderung. Bei Vorliegen von Schwerbehinderungen können in Abhängigkeit von dem Grad der Behinderung anstatt der tatsächlichen Kosten auch Pauschalen geltend gemacht werden. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach dem Grad der Behinderung.
Sammeln Sie daher unterjährig alle Rechnungen, Rezepte und Zahlungsnachweise, um am Jahresende die zumutbare Belastung prüfen zu können. Notieren Sie dabei auch die Fahrtkosten (gefahrene Kilometer).
Krankheitskosten können die Steuerlast dann erheblich mindern, wenn die individuelle zumutbare Belastung überschritten wird und der Nachweis ordnungsgemäß vorliegt. Wer also Belege sorgfältig sammelt und die steuerlichen Rahmenbedingungen kennt, kann im Rahmen der Einkommensteuererklärung zumindest einen Teil der Ausgaben zurückholen. Ein Wermutstropfen verbleibt allerdings, die bereits gezahlten Sozialversicherungsbeiträge werden über diesen Weg nicht mehr erstattet.